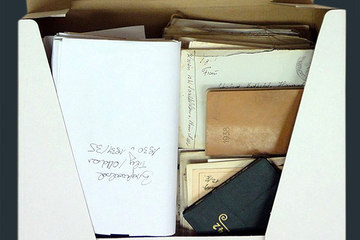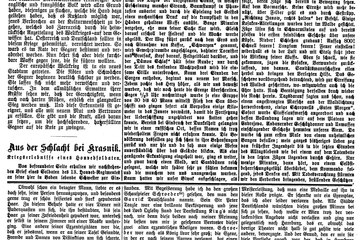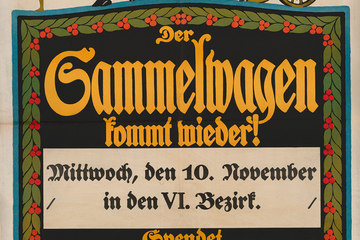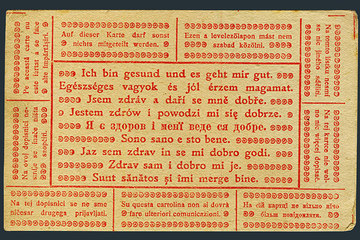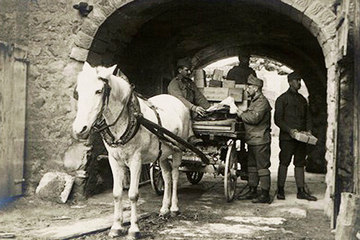Die ProtagonistInnen: Mathilde Hübner und Ottokar Hanzel
Mathilde Hübner wurde 1884 als dritte von fünf Töchtern des Ehepaares Agnes Hübner (geb. von Coulon) und Gustav Hübner in Oberhollabrunn geboren. 1895 übersiedelte die Familie Hübner in die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, wo Mathilde Hübner im selben Jahr in eine Privat-Bürgerschule für Mädchen eintrat. Ab 1898 besuchte sie die Höhere Töchterschule des Schulvereins für Beamtentöchter in Wien, wo sie jedoch nur ein Jahr absolvierte, um – wie schon ihre Eltern – im Jahr darauf die Berufsausbildung zur Lehrerin einzuschlagen.