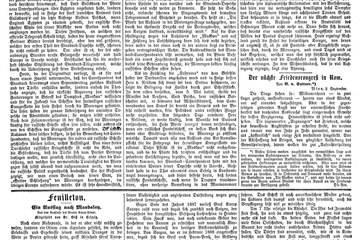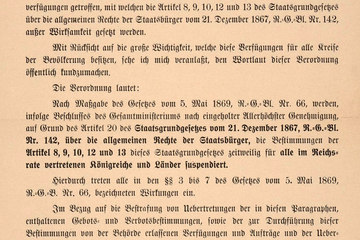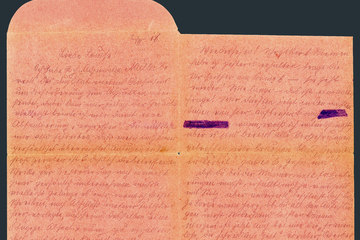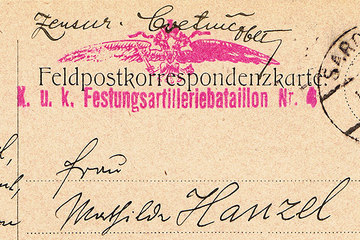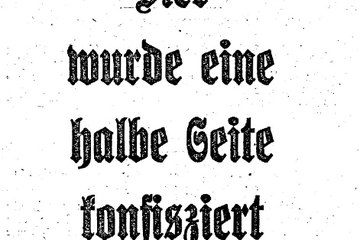„Die Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde“ – eine nur kurze Geschichte?
Der Anfang September 1891 in der Neuen Wiener Presse erschienene Artikel Bertha von Suttners mit dem Titel „Der nächste Friedenskongress in Rom“ gilt als „Geburtsstunde der Österreichischen Friedensbewegung“.