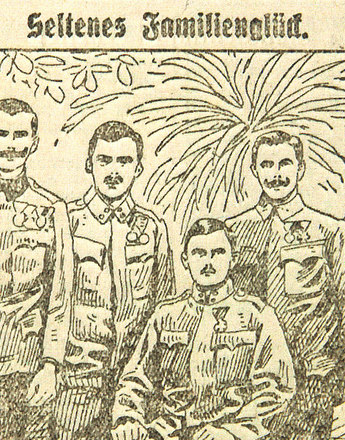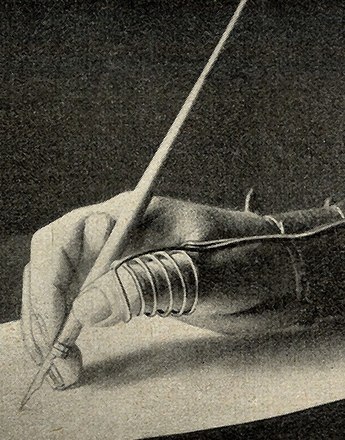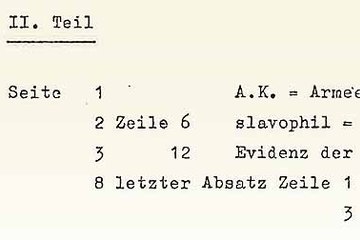-

Stellengesuche von Kriegsbeschädigten im Österreichischen Arbeitsnachweis für Kriegsinvalide vom 15. Dezember 1915
Copyright: Wienbibliothek im Rathaus
Partner: Wienbibliothek im Rathaus – Vienna Library in the City Hall -

Werbung für die k. k. Arbeitsvermittlung an Kriegsinvalide, Plakat, 1917
Copyright: Wienbibliothek im Rathaus
Partner: Wienbibliothek im Rathaus – Vienna Library in the City Hall
Kriegsbeschädigte wieder arbeitsfähig zu machen, war nicht genug. Schon im Krieg wurden daher Maßnahmen gesetzt, um sie auch tatsächlich wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern.
Kriegsbeschädigte konnten im Beruf nicht so viel leisten wie gesunde Arbeitnehmer. Das nach dem Krieg erlassene Invalidenentschädigungsgesetz bestimmte das Ausmaß der Schädigung – und damit auch die Höhe der Rente – daher nach der Minderung der Erwerbsfähigkeit. Schon während des Krieges wurden eigene Arbeitsvermittlungsstellen für Kriegsbeschädigte geschaffen, die auf die Bedürfnisse dieser Gruppe eingehen sollten. Da war es noch verhältnismäßig leicht, Kriegsbeschädigte unterzubringen, weil Arbeitgeber angesichts des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels gezwungen waren, auch Mitarbeiter mit körperlichen Beeinträchtigungen zu beschäftigen. Das Militär zum Beispiel war daran interessiert, Kriegsbeschädigte in der Rüstungsindustrie zu verwenden. Die Landeskommissionen zur Fürsorge für heimkehrende Krieger, jene Behörden, bei denen die Kriegsbeschädigtenfürsorge gebündelt war, vermittelten Kriegsbeschädigte hingegen lieber auf dauerhafte Arbeitsplätze, die ihnen auch in Friedenszeiten Beschäftigung bieten konnten.
Grundsätzlich galt die Versorgung der Kriegsbeschädigten mit Arbeit als wichtigster Baustein bei der Reintegration dieser Männer in das zivile Leben. Der Abwehrhaltung mancher Verletzter, die fanden, dass sie, die „sich die Knochen für den Staat haben kaputtschiessen lassen, […] nun auch durch den Staat erhalten werden müssen“, traten die Behörden entschieden entgegen: Erst durch die freudige Annahme einer Arbeit erweise sich ein Invalider der Versorgung durch den Staat würdig, wurde argumentiert.
Freilich war die verminderte Leistungsfähigkeit dieser Personen auch Anlass für die Idee, Kriegsbeschädigte gesondert in eigenen Invalidenerwerbs- oder Invalidenproduktionsgenossenschaften unterzubringen, wo sie der Konkurrenz mit gesunden Arbeitern nicht ausgesetzt waren. Erste Versuche dieser Art kamen aber über den Charakter von Pilotprojekten nicht hinaus. Es fehlte das Geld. Das Gleiche galt für die im Rahmen der Kriegerheimstättenbewegung angedachte Ansiedlung von Kriegsbeschädigten in eigenen, auch der Selbstversorgung dienenden Gartensiedlungen. Hier wie dort stellte man sich die Frage, ob es besser war, dass sich Kriegsbeschädigte zusammentaten, um ihr Los gemeinsam zu tragen, oder ob damit ihrer Ausgrenzung aus der Gesellschaft Vorschub geleistet würde. Kriegsbeschädigte selbst hatten oft eigene Vorstellungen von ihrem Auskommen und strebten vielfach anspruchslose Portiers- oder staatliche Versorgungsposten an. Auch Tabaktrafiken waren sehr gefragt. Sie wurden traditionell vorzugsweise an Kriegsbeschädigte, und unter diesen wiederum vor allem an Kriegsblinde, vergeben.
Nach dem Krieg regelte das Invalidenbeschäftigungsgesetz die Unterbringung der Kriegsbeschädigten auf dem Arbeitsmarkt, es ist unmittelbarer Vorläufer des heutigen österreichischen Behinderteneinstellungsgesetzes.
Healy, Maureen: Civilizing the Soldier in Postwar Austria, in: Wingfield, Nancy M./ Bucur, Maria (Hrsg.): Gender and War in Twentieth-Century Eastern Europe, Bloomington/Indianapolis 2006, 47-69
Zitate:
„sich die Knochen für den Staat …“: Österreichisches Staatsarchiv, AT-OeStA/AdR BMfsV Kb, Kt. 1357, 2748/1918, AV Troppau v. 14.7.1917
-
Kapitel
- Von Invalidenrenten, Verwundungszulagen, staatlichen Unterstützungen und Unterhaltsbeiträgen
- Das Scheitern der privaten Wohlfahrt
- Die Heilanstalten
- Von der Wiederherstellung zur Wiedereingliederung: Die Invalidenschulung
- Arbeit für Kriegsbeschädigte
- Helden oder Opfer? Kriegsbeschädigte in der öffentlichen Wahrnehmung
- Formen der Kriegsbeschädigung
- Unmut und Elend: Kriegsbeschädigte organisieren sich