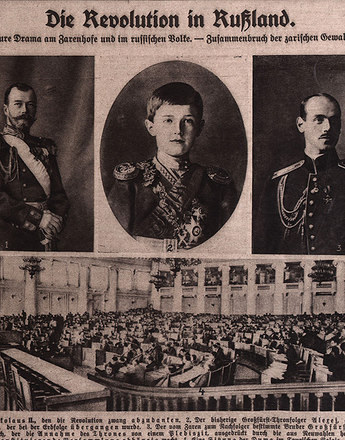-

Das Kühllagerhaus der Stadt Wien, Fotografie
Copyright: Wienbibliothek im Rathaus
Partner: Wienbibliothek im Rathaus – Vienna Library in the City Hall -

Brot- und Mehlausweis, ausgestellt von der Gemeinde Wien, 1915
Copyright: Wienbibliothek im Rathaus
Partner: Wienbibliothek im Rathaus – Vienna Library in the City Hall
Die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie, die sogenannte „Approvisionierung“, war die Achillesferse der Stadt in den dramatischen Jahren 1914 bis 1918. Wien war zum Hungern und Frieren verdammt. Das Anstellen von Hunderttausenden wurde zum Symbol der Zeit.
Als sich mit Kriegsbeginn Gemüse und Kartoffel verteuerten, verwüsteten Frauen im August 1914 auf dem Yppenplatz die Marktstände. Ein Jahr später eskalierte die Situation vielerorts vor Geschäften und auf den Märkten. Täglich stellten sich Hunderttausende (in den Berichten der Polizei 300.000 bis 500.000) unter entsetzlichen Bedingungen an, um ihre Ration Brot zu bekommen, ein Stückchen Fleisch oder ein paar Eier zu erobern. Wer dies nicht tat, lief Gefahr, überhaupt nichts zu bekommen. Die Behörden versuchten das Anstellen zu verbieten, Bürgermeister und Gemeindepolitiker traten dagegen auf – allein es half nichts. Das Anstellen wurde zu einem der Zeichen dieses Krieges. Im Spätherbst 1916 kam eine neue, eine politische Dimension ins Spiel. Jetzt griffen die Belegschaften einzelner Firmen ein, um die Belieferung mit Lebensmitteln zu erzwingen. Sie streikten, zogen mit Forderungen nach Brot und ausreichender Ernährung Richtung Innenstadt. Burschen führten mit den Polizisten ein Katz- und Mausspiel auf. Schuhgeschäfte wurden gestürmt, Bäckerautos überfallen, Fleischergeschäfte ausgeraubt. Jahr für Jahr wurden die zugeteilten Rationen kleiner und der Hunger größer, die Bevölkerung wurde zum „Abhungern“ verpflichtet. Meldungen von der Februarrevolution in Russland wirkten elektrisierend; die Parole „Brot und Frieden“ verfing auch in Wien. Erst recht versetzten die Massenstreiks des Jänner 1918 Kaiser und Regierung in Panik, weckten die Versuchung nach Verhängung des Ausnahmezustandes. Die Front wuchs nun endgültig ins Hinterland hinein. Stadt und Regierung versuchten, der Not und Revolutionsdrohung mit der Ankurbelung von Sozialpolitik (Mieterschutz, Kriegsküchen, Kriegsgärten) und der Organisation der Versorgung (Karten für Brot, Kohle, Petroleum, Kartoffel etc.) entgegenzutreten.
Bereits zu Kriegsbeginn zeigten sich die Schwächen des Versorgungssystems, zeichneten sich Engpässe bei Mehl und Fleisch, Kartoffel und Futtermehl, auch bei der Kohlenzufuhr ab. Die Zulieferung der Güter wurde reduziert. Vor allem aus Ungarn, woher vor dem Krieg mehr als fünfzig Prozent der Lebensmittel kamen, ging der Export teilweise auf ein Sechstel des Vorkriegsniveaus zurück. Auch Galizien fiel 1914/1915 als Getreidelieferant aus. Hinzu kam die Verkehrsproblematik: Bei der Priorisierung der militärischen Transporte musste die zivile Versorgung zurückstehen, gerade vor Offensiven waren die Staatsbahnen wochenlang fast ausschließlich für die Versorgung der Armee reserviert. Die Stadt mobilisierte, was und wo sie konnte: Sie stellte die Straßenbahnen mit Güterzügen in den Dienst der städtischen Versorgung, unterstützte mit sechzig zweispännigen Fuhrwerken aus dem städtischen Fuhrwerksbetrieb den Kohlenvertrieb.
Bürgermeister Richard Weiskirchner fand sich in einem komplizierten Kompetenzgefüge wieder. Die Gemeinde hatte einerseits eine relative Autonomie in den Entscheidungen des selbstständigen Wirkungskreises, andererseits war sie nachgeordnete Instanz der mittelbaren Zentralverwaltung, musste im übertragenen Wirkungsbereich Erlässe von Regierung und niederösterreichischer Statthalterei vollziehen. Weiskirchner versuchte immer wieder auf die niederösterreichische Statthalterei und die Regierung einzuwirken, einerseits um konkrete Unterstützung zu erhalten, andererseits um gewünschte Erlässe und Verordnungen durchzusetzen. So wurde im Herbst 1914 die Einführung von Höchstpreisen bei Mehl und Getreide in der ganzen Monarchie verhandelt. Dies stieß aber immer wieder auf Widerstand der Regierung und der Militärs. Nur für Niederösterreich gültige Höchstpreise (Kundmachung vom 31. August 1914) hatten die fatale Folge, dass die Belieferung Wiens noch weniger funktionierte, die Waren vom Markt einfach verschwanden. In besonderem Maß führten der sogenannte Steckrübenwinter von 1916/17 und die Brot- und Mehlreduktionen im Jänner 1918 die Stadt an den Rand des Kollapses.
Beiträge von Healy, Maureen/Mertens, Christian/Berger, Peter/Langthaler, Ernst in: Pfoser, Alfred/Weigl, Andreas (Hrsg.): Im Epizentrum des Zusammenbruchs. Wien im Ersten Weltkrieg, Wien 2013, 336-347
Hautmann, Hans: Hunger ist ein schlechter Koch. Die Ernährungslage der österreichischen Arbeiter im Ersten Weltkrieg, in: Bewegung und Klasse. Studien zur österreichischen Arbeitergeschichte, Wien 1978, 661-681
Healy, Maureen: Vienna and the Fall of the Habsburg Empire. Total War and Everyday Life in World War I. Cambridge 2004
Loewenfeld-Russ, Hans: Die Regelung der Volksernährung im Kriege. Wien 1926 (Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Weltkrieges)
-
Kapitel
- Kriegsbürgermeister Richard Weiskirchner
- Das politische System: Die Obmännerkonferenz und der Gemeinderat
- Noch einmal Hauptstadt der Monarchie: Mehr Bevölkerung, mehr Aufgaben, mehr Bürokratie, weniger Ressourcen
- Die „Approvisionierung“
- Staatliche, kommunale und freiwillige Fürsorge
- Der Mieterschutz
- „Die sterbende Stadt“